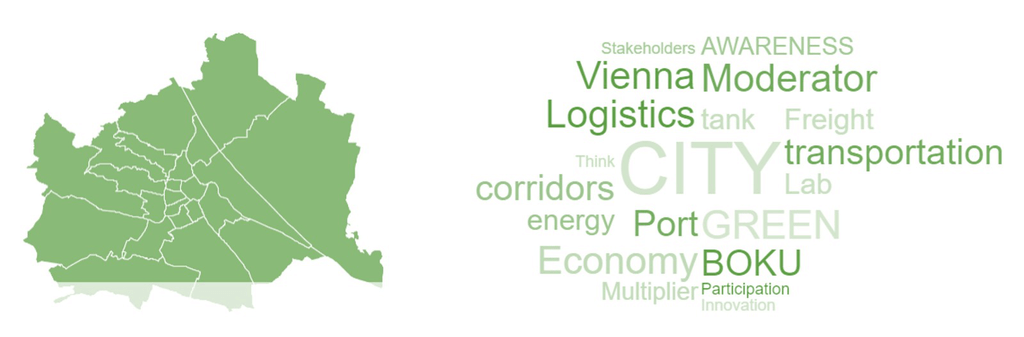supporting sustainable urban logistics solutions
thinkport VIENNA is an open mobility laboratory which confronts the challenges of urban logistics and develops comprehensive, long-term solutions. We are a neutral, objective, and competent point of contact for topics relating to freight logistics in the city of Vienna.
Our vision is to promote logistics solutions for a liveable city and to create space for sustainable solutions. For us, logistics is more than just a function in the supply and disposal of urban spaces. For us, enthusiasm and openness are keys to innovation. Vienna should become the city for innovative, sustainable logistics in the international arena. Through the commitment of our principal we provide real test environments to take theory and concepts through to tried and test applications. On one hand we aim to create an open environment for innovation and co-creation, on the other, offer a real test environment for the methodical development of urban logistics concepts.
enable innovative logistics for sustainable cities – intended to inspire